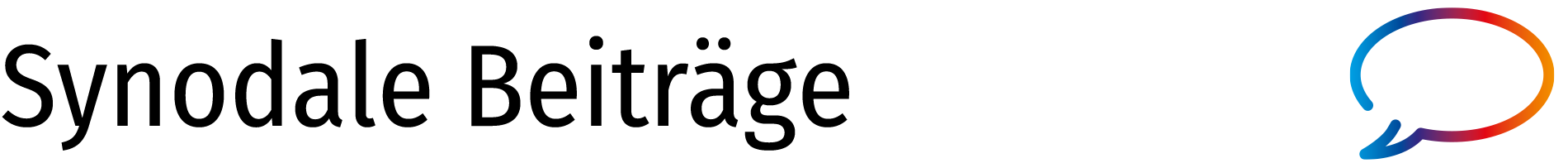21. März 2022 | Eros reitet auf dem Panther.
Autor: Prof. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
Quelle: "L". Magazin der Legionäre Christi und des Regnum Christi
Nietzsche hatte behauptet, das Christentum habe dem Eros Gift zu trinken gegeben; er sei zwar nicht daran gestorben, aber zum Laster entartet.[1] Selbst wenn das in dieser Brutalität nicht stimmt, ist doch bei vielen Zeitgenossen dieser Verdacht nachhaltig eingedrungen. Ist die Lust mehr eine Last?
Um darauf eine redliche Antwort zu geben, sollte die vorchristliche Erfahrung einmal ohne die Brille Nietzsches aufgerufen werden. Wie ging die griechische Kultur selbst mit dem geflügelten Kindgott Eros um? Seit der Vereinigung seiner Mutter Penia, der Armut, mit seinem Vater Poros, dem Reichtum, wie in Platons Symposion geschildert, ist Eros ein zwielichtiges Wesen. Er verkörpert die Bandbreite von der leidenschaftlichen, auch anonymen Triebhaftigkeit, der Armut des Bedürftigen, bis zum unwiderstehlich beseligenden göttlichen Überfluss, dem Reichtum des aus der Fülle Liebenden. Eros ist ein Zwitter aus drängender Not und unbändiger Hingabe, und der Panther kann ihn jederzeit abwerfen. In der „Antigone“ des Sophokles heißt es: „Eros, unbezwungen im Kampf. Eros, dein ist, was du anfällst. Keiner der Götter entrinnt dir, noch Eintagsmenschen. Wen es erfasst, die rasen. Auch den Gerechten in Unrecht lockst du und Schande. Du hast die Männer zerworfen zum Hader auch verwandten Blutes. Siegend bezeugt sich auf bräutlichem Lager lieblicher Augen Reiz.“
Im Alten Testament finden sich in dem kostbaren Buch des Hohenliedes ähnlich mehrfache Möglichkeiten: die gattungshafte Liebe, die noch „alle“ meint und sich in der Atmosphäre der Liebelei wohlfühlt (hebräisch dodim, ein Plural), und die entschiedene persönliche Liebe, auch in der Gestalt des Schmerzes (hebräisch ahaba). Sie ist jene Liebe die bis ins Unerfüllte lieben muss, sie ist jenes Exzessive, das nicht mehr im Besitzen und Genießen, sondern sogar im Verlieren liebt. Diese Liebe gibt nicht etwas, sondern sich selbst. So auch die endgültige Liebe zwischen Mann und Frau: Sie ist eine Urkraft, die mit dem Tod und der Härte der Verlusterfahrung verbunden ist. Aus der Kenntnis dieser verzehrenden Kraft aller Kräfte speist sich eine christliche Überzeugung, heute freilich gebrochen durch die Frage, ob eine solche unbedingte Liebe dem heutigen Bewusstsein noch geläufig ist.
Das Christentum übernahm aus der antiken, insbesondere der jüdischen und griechischen Welt viele dieser gelebten, heimlich-unheimlichen Erfahrungen, stellte aber das Ganze unter den Anspruch Christi und seiner evangelischen Räte. Damit sind in das Erotische einerseits Warnungen, andererseits Klärungen eingebracht. Drei Hinsichten auf die christliche Überzeugung seien versucht. Der „neue Weg“ betraf insbesondere die „Zähmung“ des Eros im Blick auf seine gattungshafte Triebungebundenheit. Sie gilt als eine Suchphase, die geläutert, ja gezogen werden muss, bis sie tatsächlich in eine eindeutige, im Glücksfall strahlend einzigartige Beziehung übergeht. So lenkt Christentum entschieden hin auf den Eros in Gestalt der Ehe. Das freie Schweifen des Triebes wird in eine persönliche, ja monogame eheliche Unauflöslichkeit umgeschmolzen, übrigens vorwiegend zum Schutz der Frau. Zwei Leistungen setzte das Christentum für die Ehe durch, die auch gegen heutigen Widerstand als Leistungen zu sehen sind: zum einen wird in der monogamen Ehe der Singular, vor allem der weibliche Singular, wirklich erzwungen. Und zum Zweiten wird die Ehe unauflöslich, was den Ernst der Hingabe ein für allemal betont. Aller Dinge Köstlichstes ist, was ewig ist, sagt Augustinus.
Es öffnet zugleich den großen Horizont des Eheverständnisses, denn das Sprühende des Eros ist damit nicht einfachhin verschwunden oder sogar kastriert. Es gibt gerade in der christlichen Ehe (und vielleicht nur in ihr) die Stelle, wo der geschichtliche Vollzug, das Spiel von Mann und Frau in die ursprüngliche Freiheit, Spontanität und Göttlichkeit des Eros eingerückt wird. Denn eben das Göttliche ist im Gedanken des Sakramentes enthalten und mehr noch: gewahrt. Im Vollzug der geschlechtlichen Einung, im Vollzug der Liebe gerade auf ihrer leiblichen Ebene, ist Gott gegenwärtig. Nicht der Priester spendet das Sakrament vor dem Altar, sondern die beiden Liebenden lassen Gott erscheinen in der geschlechtlichen Vereinigung als dem sinnlichen Zeichen seiner unsichtbaren Gnade.
In den 2000 Jahren christlicher Geschichte sind noch andere Möglichkeiten unterschiedlich ausgeprägt und gelebt worden: Eros wird in der Ehe konzentriert, Philia (Freundschaft) meist in den Orden kultiviert, während Agape als Hochform der Liebe nicht an eine bestimmte Beziehung gebunden ist. Sie hat ihr Urbild in der unverbrüchlichen Liebe Gottes zu seiner Schöpfung. Philia trägt im Abendmahlssaal die Grundhaltung zwischen Jesus und seinen Jüngern, den „philoi“.
Die Orden wären eigentlich Träger dieser tiefen, durch die gemeinsame Sache (tertium commune) vermittelten freundschaftlichen Beziehung. Sie kann und soll christlich auch zwischen den Geschlechtern gelebt werden, da gerade das Christentum von dem Menschen spricht, der „mehr“ ist als sein Geschlecht; Philia wäre ein Grundbezug zwischen reifen Glaubenden, deren Freundschaft durch eine gemeinsame Hoffnung auf Christus getragen ist. Letztlich ist Agape die Liebe schlechthin, reines Geschenk eben jenes Gottes, der „umsonst“ liebt. Es ist wundervoll, wenn im Christentum immer wieder Gestalten solcher Agape auftauchen. Die heutige zeitgenössische Unkultur des Trieblebens wäre aus solchen anrührenden Erfahrungen neu zu kultivieren.
Weit über Nietzsche hinaus gilt ein grandioser Satz: „Auch die Kirche hat ihre mächtigen Utopien, die ‚Geschichte gemacht’ und den Menschen verändert haben: die eine, die kühnste, die atemberaubendste ist das Mönchtum: feurige Boten der Wahrheit und Liebe. Die andere ist die Ehe: ewig unauflösliche, unbegreifliche Einheit von Geschlecht, Eros, Freundschaft, Liebe, Agape, Fruchtbarkeit.“[2]
Die Sprache des Leibes
Personsein meint antworten auf Anruf; dies gelingt am dichtesten in der Liebe. Sie lässt den Menschen in sich gründen, treibt ihn aber mehr noch über sich hinaus: dem anderen zu. Geschieht dies im Geschlecht, so kommt es sogar zu einer Fleischwerdung im anderen.
Hier kommt das andere Geschlecht entscheidend ins Spiel. Das Hinausgehen aus sich ist unvergleichlich fordernder, wenn es nicht nur auf ein anderes Ich, sondern auf einen anderen Leib trifft – auf unergründliche Andersheit, unergründliche Entzogenheit, manifest bis ins Leibliche, Psychische, Geistige hinein. Diese Differenz auszuhalten, vielmehr sich in sie hineinzubegeben und hineinzuverlieren, erfordert wirklichen Mut. Vielleicht ist nur die Liebe im Sinne von Tollkühnheit fähig, sich überhaupt einzulassen auf die Andersheit des anderen Geschlechtes.
Denn das andere Geschlecht ist nicht zu vereinnahmen, nicht auf sich selbst zurückzuspiegeln: Frau ist bleibendes Geheimnis für den Mann und umgekehrt. Der Mann wird nur an der Frau zum Mann und Vater, die Frau nur am Mann zur Frau und Mutter. Im geschlechtlich Anderen begegnet man nicht zuletzt der eigenen Kraft zum elterlichen Dasein. Die neue Generation entsteht nur aus Mann und Frau. Natürlich kann auch der Schritt in die Differenz missglücken. Es macht die Not der Existenz aus, dass sie alle Lebensvollzüge degradieren kann. Es gibt die Zweckgemeinschaft Ehe, den Selbstgenuss im Sex, das frustrierte, leergewordene Zölibat, das erzwungene, lähmende Alleinsein, den Egoismus zu zweit.
Aber das hindert nicht anzuerkennen, dass die Bipolarität der Geschlechter ein optimum virtutis, ein Äußerstes an Kraft herausfordert und andere geschlechtliche Vollzüge überholt.
Aber auch kulturell gilt: Das Geschlecht ist unter allen sonstigen Unterscheidungen zwischen Menschen (Alter, Ethnie usw.) einzigartig, so dass es in keiner Kultur auf Dauer unterlaufen werden kann. Auch Gleichgeschlechtlichkeit benutzt die „Rollenmodelle“ männlich/weiblich, wie selbst Judith Butler bemerkt hat[3]: Das Schloss-Schlüssel-Modell ist nicht zu unterlaufen. Darin zeigt sich eine durchgängige geschlechtlich differenzierte Leibbestimmtheit des Daseins[4].
Könnte über alle Morallehren hinweg, die doch nicht greifen, die alte Genesis-Vision erneuert werden, dass in der Zumutung und lockenden Fremdheit der beiden Geschlechter sich doch am Grund die Begegnung der göttlichen Dynamik abspielt, das unerhörte Leben Gottes selber das Spiel der Geschlechter hervorruft, Er als Ur-Bild, das alle Bilder sprengt?
Gott als Anderer, Fruchtbarer, Lockender
In der Regel unterschätzen wir den explosiven Beginn der Genesis (1,27): „Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis. Als Mann und Frau schuf er sie.“ In der Zweigeschlechtlichkeit lässt sich El, der sonst Bildlose, sehen. Und dieser religiös ungewohnte Schritt unterstreicht das Götzenbilderverbot: keine Bilder Jahwes außer dem von ihm selbst gewollten - dem Menschen. Mann und Frau sind die Bildfreude Gottes.
Damit eröffnet sich ein unerhörtes Beziehungsgeflecht: Wir selber sind theomorph, Gott fraulich oder männlich nachgestaltet. In dieser merkwürdigen Erkenntnis hat besonders die Tatsache Raum, dass sich jeder Mensch als geschlechtliches Wesen erfährt. Und das bedeutet sofort, dass er sich selbst nicht genügt, nach dem Fehlenden unterwegs ist.
Dieser Mangel ist so stark, der Drang zur Ganzheit so zwingend, dass er außerhalb des jüdisch-christlichen Denkens von einem Gott verkörpert und nur von einem Gott geheilt werden kann: von Eros. Der Kugelmensch bei Platon, der sich „früher“ selbst genügte, Adam im Garten Eden, der Eva noch in sich trug, bevor sie sich „dann“ von ihm trennte zu einem „Gegenüber“ - wäre das nicht eigentlich das eine Abbild des einen Gottes gewesen? Die Trennung der Kugel aber, die die Griechen als Unglück empfinden, wird in der Genesis als Glück gezeichnet: Zwei Menschen erhalten das Ebenbild des Einen aufgeprägt, zwei sollen fruchtbar sein, zwei sollen herrschen - Gaben, die aus der Doppel-Ebenbildlichkeit folgen. Die Genesis zeichnet Mann und Frau, gerade weil sie zwei sind, als von Gott kommend, mit seiner Verwandtschaft geschmückt, als Doppelansicht des Unsichtbaren.
Der tiefste anthropologische wie theologische Gedanke des Schöpfungsberichts ist wohl jener, dass die menschliche Liebesgemeinschaft von Mann und Frau eine Ahnung von der Liebesgemeinschaft in Gott selbst verleiht - ja, dass sich gerade an der Geschlechtlichkeit des Menschen, so geheimnisvoll sie für sich selbst schon ist, das eigentliche Geheimnis, nämlich das unerhörte, unvorstellbare schöpferische Füreinander und Ineinander des göttlichen Lebens ausdrückt. Dieser Gedanke ist in dem Apostolischen Schreiben Mulieris dignitatem vorrangig betont worden: „Diese ‚Einheit der zwei’ (...) weist darauf hin, dass zur Erschaffung des Menschen auch eine gewisse Ähnlichkeit mit der göttlichen Gemeinschaft (communio) gehört.“
Anders: Die Geschlechtlichkeit von Mann und Frau lässt bereits die Wahrheit anschaulich werden, dass Gott in sich selbst Liebe ist (1 Joh 4,16). Schon von der zweifachen Gestalt des Menschen her wäre klar, dass Gott nicht monolithisch, selbstgenügsam, schweigsam, verschlossen ist, vielmehr Hingabe, Gespräch, Beziehung - eben Liebe. Menschliche geschlechtliche Gemeinschaft als Abglanz der göttlichen Gemeinschaft - damit wäre der griechischen Trauer über die Zweiheit des Menschen eine unglaubliche Antwort gegeben: statt Trauer die Seligkeit, kraft der Trennung in Geschlechter Gottes innere Dynamik abzubilden.
Und wie die menschliche Zweiheit auf Gottes Leben zurückweist, auf sein inneres „Spiel“ von Geben und Empfangen, Reichtum und Armut, Bedürfen und Stillen, Lieben und Sich-Lieben-Lassen, so gilt im vielfältigen Netz der Bezüge wiederum umgekehrt, dass Gottes Einssein auch unsere Zweiheit zu Einem fügt.
Hildegard von Bingen (1098-1179) nennt Mann und Frau „ein Werk durch den anderen“, das in Wirklichkeit ein einziges gemeinsames Werk vorstelle.[5] Ob man sich also dem Menschen oder Gott von der Vielfalt oder der Einheit her annähert: immer wird die lebendige Spannung in dem Einen oder die Einheit, alle Spannung unterfangend, sichtbar. Und dies nicht als Schreibtisch-Gedanke, sondern als höchste Anstrengung einer jüdisch-christlichen Fassung von Geschlechtlichkeit.
Diese Wahrheit ist lebensbestimmend: Wie tief in Ihm der Ursprung alles Lebendigen, alles Menschlichen, des Eros zwischen den Geschlechtern, ja der unbeschreiblichen Freude der Mutterschaft und Vaterschaft zu verehren ist. Deswegen ja auch die Fassung der Ehe als Sakrament: Gott als Weg von mir zu dir. Geschlechtlichkeit als Fenster und Durchsicht auf seine Gegenwart.
Das letzte Konzil hat dankenswert die verschiedenen Ehezwecke umgestellt und die gegenseitige Liebe in die erste Bedeutung gehoben. Nach wie vor freilich ermangeln Alltag wie Lehre einer christlichen Erotik, die auf der Genesis (und der paulinischen und johanneischen Theologie) gründet, nicht modisch erfunden werden will, sondern als Schatz aus dem Acker gehoben gehört. Und wenn sich die christliche Erotik auf den dreieinen Gott selbst beruft, was würde dies für das ungewiss ferne Gottesbild bedeuten?
Man kann der gegenwärtigen Kultur nur wünschen, von ferne den Saum dieser göttlich-erotischen Erfahrung zu berühren. „Haben wir denn den richtigen Begriff von der Liebe? Er ist bei uns oft sentimental, weichlich geworden. (…) Die Moderne muss die Liebe als etwas viel Weiträumlicheres, Furchtbareres und Gewaltigeres denken, als sie es tut.“[6]
______________________
[1] Jenseits von Gut und Böse, Nr. 168.
[2] Ida Friederike Görres, Zwischen den Zeiten. Aus meinen Tagebüchern 1951 bis 1959, Olten/Freiburg 1960, 188.
[3] Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt 1991, 58.
[4] Ute Gahlings, Phänomenologie der weiblichen Leiberfahrungen, Freiburg/München 2006. Edith Stein, Die Frau. Fragestellungen und Reflexionen, Freiburg 32004. H.-B. Gerl-Falkovitz, Frau – Männin - Menschin. Zwischen Feminismus und Gender, Kevelaer 22016; dies., Eros – Glück – Tod und andere Versuche im christlichen Denken, Gräfelfing 22014.
[5] Hildegard von Bingen, Heilkunde, Salzburg 1957, 37.
[6] Lauterkeit des Blicks. Unbekannte Materialien zu Romano Guardini, hg. von H.-B. Gerl-Falkovitz, Heiligenkreuz 2013, 90.